Von Julia Korbik — 14. April 2016
Simone de Beauvoir macht es jungen Frauen nicht gerade leicht, sich ihr anzunähern. Sie ist streng, schwer zugänglich und nicht unbedingt auf Anhieb sympathisch. Über eine Ikone, die man erst durch ihre Widersprüche versteht.
Prolog
Für die meisten Feministinnen und Frauen ist Simone de Beauvoir heute nicht mehr als die strenge Frau auf ihren Memes. Da stehen dann schlaue Sprüche wie „Man wird nicht als Frau geboren, man wird es“. Gelesen hat Beauvoir aber kaum eine. Sie ist zu einer der Autorinnen geworden, die sehr viel zitiert und sehr wenig gelesen werden. Mein Weg zu Beauvoir war genau andersherum.
In meiner Berliner Wohnung steht oben auf meinem Bücherregal eine lila Kiste. Sie ist gefüllt mit alten Tagebüchern, viele davon schlichte schwarze Moleskine-Notizbücher und in vielen davon, verstreut, findet sich, immer wieder, Simone de Beauvoir. Der erste Eintrag stammt aus dem Januar 2007.
In Rot habe ich oben auf die Seite „Simone de Beauvoir (1908-1986)“ geschrieben, darunter klebt ein Ausdruck aus dem Internet: „Freiheit, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung betrachten Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir als die Fundamente aller Werte. Sie gehen davon aus, dass der Einzelne sich erst durch seine Handlungen definiert; es komme darauf an, sich zu entscheiden, ohne sich hinter Traditionen und Religionen, Doktrinen und Ideologien zu verstecken – auch wenn die Verdammung zur Freiheit Angst hervorrufe.“
Februar 2007. Ich war 19, kämpfte mit einer fiebrigen Nasennebenhöhlenentzündung und versuchte, mich im Bett auf das Abitur vorzubereiten. In meinem Tagebuch notierte ich: „Hier zu Hause ist es totlangweilig. Immerhin habe ich heute Morgen endlich Memoiren einer Tochter aus gutem Hause zu Ende gelesen. Simone ist einfach meine absolute Heldin.“
Ein paar Monate später, im Mai, las ich die Briefe von Beauvoir an Sartre: „Ich bin jetzt bei den Briefen im Jahr 1941 angelangt, fast schon bei 1943. Es ist unglaublich, mit welcher Zärtlichkeit Simone Sartre anspricht, man merkt einfach, dass er ihr absoluter Lebensmittelpunkt ist. Und trotzdem haben die Beiden sich nie gegenseitig eingeengt. Wobei ich nicht glaube, dass die Beziehung dermaßen ideal war, wie sie immer dargestellt wird. Eifersucht hat dort sicher auch ihren Platz gehabt.“
 Heute erscheint mir dieser Kommentar erstaunlich hellsichtig, denn zum Zeitpunkt des Tagebucheintrags hatte ich nur Literatur von Simone de Beauvoir gelesen, aber noch nichts über ihr Leben. Der Kommentar zeigt auch, dass ich schon früh ahnte, dass Beauvoir mehr Mythos ist als Realität: eine überlebensgroße Figur, deren Namen sehr viele kennen – mehr aber nicht.
Heute erscheint mir dieser Kommentar erstaunlich hellsichtig, denn zum Zeitpunkt des Tagebucheintrags hatte ich nur Literatur von Simone de Beauvoir gelesen, aber noch nichts über ihr Leben. Der Kommentar zeigt auch, dass ich schon früh ahnte, dass Beauvoir mehr Mythos ist als Realität: eine überlebensgroße Figur, deren Namen sehr viele kennen – mehr aber nicht.
Und alle paar Jahre erinnert sich dann die Welt daran, dass es die Schriftstellerin, Philosophin, Feministin Simone de Beauvoir gegeben hat. Am 14. April 2016 jährt sich ihr Todestag zum 30. Mal. Wie schon anlässlich ihres 100. Geburtstags am 9. Januar 2008 werden viele Nachrufe erscheinen, wohl einige von Beauvoirs Büchern neu aufgelegt – vielleicht nicht einmal das. Danach ebbt das Interesse ab und die Französin verschwindet erneut in der Versenkung. Zumindest ist das mein Eindruck. Vielleicht bin ich zu nah dran an Beauvoir, an ihren Büchern, Ideen, an ihrem Leben. Vielleicht werde ich deswegen immer finden, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Aufmerksamkeit lässt sich nicht präzise messen. Wieviel Aufmerksamkeit ist genug? Was bedeutet es, „viel“ Aufmerksamkeit zu bekommen?
Simone de Beauvoir hat mir so viel gegeben und ich frage mich, ob das bei anderen jungen Frauen aus meiner Generation auch so ist. In den feministischen Kreisen, in denen ich mich häufig bewege, kennt man Beauvoir natürlich. Sie ist die Autorin von Das andere Geschlecht, natürlich hat man von ihr gehört. Vielleicht hat man diesen feministischen Klassiker sogar gelesen – vielleicht aber auch nicht. Oft höre ich von anderen jungen Feministinnen: „Ich sollte das ja mal lesen, aber…“, begleitet von einem schuldbewussten Schulterzucken.
Früher dachte ich, dass es in Simone de Beauvoirs Heimatland sicher anders sein müsse. Dass junge Frauen dort sie kennen, ihre Bücher lesen, ihre Theorien diskutieren. Mein Studium im französischen Lille zeigte mir aber: Das stimmt nicht. Wenn ich mich hingegen mit älteren Frauen unterhalte, ob in Deutschland oder Frankreich, hat fast jede eine Geschichte über Beauvoir zu erzählen – und nicht nur die Frauen, die sich als Feministinnen verstehen. Mit ihnen hat Beauvoir etwas gemacht, hat ihnen durch ihr Schreiben, ihr Leben – denn bei Beauvoir sind Werk und Leben eins – etwas gegeben. Geht es um Beauvoir, das ist meine Erfahrung, gibt es tatsächlich so etwas wie eine Teilung zwischen verschiedenen Frauengenerationen.
Am 14. April wird es 30 Jahre her sein, dass Simone de Beauvoir starb, im Alter von 78 Jahren. Ich frage mich: Welche Rolle spielt sie heute noch für junge Frauen, junge Feministinnen? Was können junge Frauen meiner Generation noch von Beauvoir lernen? Ich finde, Simone de Beauvoir macht es jungen Frauen heute auch nicht gerade leicht, sich ihr anzunähern. Sie ist eine widersprüchliche Person, eine, die nicht sofort sympathisch wirkt und eine gewisse Strenge ausstrahlt.
Simone de Beauvoir ist kein perfektes Vorbild. Aber gerade das macht sie interessant.
I. Simones Geschichte: Frau von Schönblick mit dem Turban
Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir und ich begegneten uns zum ersten Mal in der Schule, genauer gesagt im Religionsunterricht in der 9. Klasse. Eine Mitschülerin und ich mussten ein Referat über den Philosophen Jean-Paul Sartre halten. Da wir im Unterricht
generell nicht gerade dem klassischen Religionsprogramm folgten (u.a. lasen wir Romeo und Julia sowie Das Parfum), fiel ein existentialistischer, atheistischer Philosoph kaum weiter auf.
Zur Vorbereitung lasen meine Mitschülerin und ich Sartres Drama Die Fliegen (ehrlich gesagt waren es nur ein paar Seiten und dann die Zusammenfassung im Internet). Überfordert blätterten wir durch das im wahrsten Sinne des Wortes gewichtige Das Sein und das Nichts mit seinen weit über 1000 Seiten. Bei der Suche nach passenden Bildern für die Präsentation fanden wir etliche Karikaturen, alle recht ähnlich: Sartre mit monströser Pfeife im Mund, die Ohren riesig, ein Auge wild herumwandernd.
Und dann war da eine Frau zu sehen, sie trug eine Art Turban und blickte streng.
 Laut Bildbeschreibung handelte es sich dabei um Simone de Beauvoir – ich hatte noch nie etwas von ihr gehört. Eine kurze Google-Suche ergab, dass es sich bei ihr um Sartres Lebensgefährtin handelte. Schriftstellerin, Philosophin, Feministin. So weit, so uninteressant. Ich hielt das Referat, ohne mich weiter mit Frau von Schönblick zu beschäftigen.
Laut Bildbeschreibung handelte es sich dabei um Simone de Beauvoir – ich hatte noch nie etwas von ihr gehört. Eine kurze Google-Suche ergab, dass es sich bei ihr um Sartres Lebensgefährtin handelte. Schriftstellerin, Philosophin, Feministin. So weit, so uninteressant. Ich hielt das Referat, ohne mich weiter mit Frau von Schönblick zu beschäftigen.
Einige Zeit später, ich war nun in der 11. Klasse, erspähte ich im Buchladen Simone de Beauvoirs Roman Die Mandarins von Paris und ich erinnerte mich. Plötzlich war ich von prickelnder Freude erfüllt – der Einband versprach einen „faszinierenden Einblick in das Paris der Existentialisten“, das Titelfoto zeigte eine Gruppe von Menschen, darunter Sartre, die in einem Café miteinander diskutierten. Erst heute fällt mir auf, wie seltsam das ist: Dass auf einem Buch über das Leben Intellektueller im Frankreich der Nachkriegszeit Sartre zu sehen ist, die eigentliche Autorin Beauvoir aber nicht. Damals störte mich das wenig.
Ich war 17, frankophil und sehnte mich nach Pariser Cafés, der Seine, dem Intellektuellen-Milieu. Ich brauchte dieses Buch, es war ein nahezu körperliches Bedürfnis – wie Hunger oder Durst. Mehrere Wochen schlich ich um die Mandarins herum. Es war die Zeit, als ich von meinen Eltern noch Taschengeld erhielt und mir gut überlegen musste, wofür ich dieses ausgeben wollte. Ein Freund schenkte mir das Buch schließlich zum 18. Geburtstag.
Mit den Mandarins entdeckte ich schließlich endlich und endgültig Simone de Beauvoir für mich. Ich las im Internet alles über sie, was ich finden konnte: Sie wird 1908 in Paris in eine ursprünglich wohlhabende Familie geboren, die aber später durch den Ersten Weltkrieg und damit verbundene Fehlspekulationen einen Großteil ihres Vermögens verliert. In dieser Welt des französischen Großbürgertums herrscht ein ausgeprägtes Standesbewusstsein. Männer haben alle Freiheiten, Frauen sollen zurückhaltend und enthaltsam sein. Beauvoir und ihre Schwester Hélène werden von der Mutter streng katholisch erzogen, Beauvoir verliert aber im Teenager-Alter ihren Glauben – ganz wie ihr großes Vorbild, ihr Vater, ein Atheist.
Den Schwestern Beauvoir wird schon früh klar gemacht, dass sie einen Beruf ergreifen werden müssen: Ihr Vater kann ihnen keine Mitgift zahlen, sie müssen für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen. Das passt Simone de Beauvoir ganz gut, denn sie will sowieso Schriftstellerin werden. Zunächst entscheidet sie sich aber für eine Laufbahn als Lehrerin, studiert französische Philologie und Mathematik und ab 1926 Philosophie an der Sorbonne. Dort trifft sie ihren zukünftigen Lebensgefährten, den drei Jahre älteren Jean-Paul Sartre.
Bei der prestigeträchtigen und wettbewerbsbetonten Prüfung für angehende Gymnasiallehrer belegt Beauvoir hinter Sartre den zweiten Platz. Einer der Prüfer erzählt später, der Prüfungsausschuss habe lange debattiert – man sei sich einig gewesen, dass Beauvoir die wahre Philosophin sei und nicht Sartre. Aber da Sartre bei der Prüfung im Jahr zuvor bereits einmal durchgefallen, ein Student der angesehenen École Normale Supérieure und außerdem ein Mann war, habe an ihm den ersten Platz gegeben.
Kein Wunder, dass man von Simone de Beauvoir heute selten als Philosophin spricht. Die Philosophie war und ist eine Männerdomäne und Beauvoir war nun mal eine Frau. Und das spielte in ihrem Leben stets eine sehr große Rolle.
II. Simone als Vorbild: Warum es so kompliziert ist, eine perfekte Heldin zu haben
„Im Philosophieunterricht spricht man nicht von Simone de Beauvoir“, sagt die junge Französin Julia. „Sie wird nicht als jemand betrachtet, der neue, revolutionäre Ideen beigetragen hat. Dabei gehörte sie zu einer sehr wichtigen Bewegung: dem Feminismus“. Sie zuckt die Achseln. „Aber ich glaube, das ist allgemein ein Problem, wenn es um die Darstellung von Beauvoir geht: Feminismus wird als ein Sonderthema wahrgenommen und beispielsweise nicht als eine philosophische Strömung.“ Es ist Anfang Januar und mild für einen Wintertag. Wir sitzen in einer Bar, nahe der Pariser Place de la République. Für einen Abend mitten in der Woche ist die Bar gut gefüllt, Musik dröhnt aus den Lautsprechern, mischt sich mit dem Klirren von Gläsern und Unterhaltungen der Gäste.
Julias Ausführungen erinnern mich an eine Begebenheit während meines Studiums. Ich war Teil eines deutsch-französischen Studiengangs und musste in Frankreich, wie alle deutschen Studierenden, den Französisch-Unterricht besuchen. Am Anfang des Semesters verteilte unser Dozent Referatsthemen. Er hatte sich vier literarische Hauptthemen ausgesucht, darunter auch Les intellectuels, die Intellektuellen. Zu jedem Thema gehörten verschiedene Texte, die in einem Referat präsentiert werden sollten, inklusive Vorstellung des jeweiligen Autors. Ich warf einen Blick auf die Liste: Nur männliche Namen.
Keine einzige französische Autorin war offenbar wichtig genug, um in einem Kurs behandelt zu werden, der 200 Jahre französische Geschichte umspannte. Keine Madame de Staël, keine Colette, keine Françoise Sagan. Also ging ich nach dem Unterricht zu dem Dozenten. Ich würde gerne einen eigenen Referats-Vorschlag machen, sagte ich, denn auf der Liste stände keine einzige Frau. Meinem Dozenten war das Ganze offensichtlich unangenehm – er hatte die Liste erstellt, ohne daran zu denken, auch Autorinnen aufzunehmen. Keine böse Absicht, aber doch so typisch für den Umgang mit Frauen in der Geschichte. Ich schlug Simone de Beauvoir als Referatsthema vor. Mein Dozent akzeptierte. Später gab er mir für das Referat, in dem ich einen Ausschnitt aus Beauvoirs Debutroman Sie kam und blieb analysierte, eine überaus gute Note. Eine Art Wiedergutmachung? Ich weiß es nicht.
Zurück in Paris nimmt Julia einen Schluck von ihrem Bier. Sie ist 27 und Ingenieurin, ihr Haar blond und kurz. Wir haben uns verabredet, weil Julia zusammen mit ihrer Freundin eine feministische Initiative gegründet hat: Des Simones, zu Deutsch: die Simonen. „Ich wollte gerne Dinge herstellen und Textiltechniken benutzen. Ich bin eher nicht so der hyper-intellektuelle Typ, ich mache lieber praktische Sachen. Als ich angefangen habe, mich für Aktivismus zu interessieren, wollte ich erst Femen beitreten.“ Julia grinst. Statt barbusig gegen das Patriarchat zu kämpfen, bedruckt sie nun im Siebdruckverfahren Secondhand-T-Shirts mit den Konterfeis mehr oder weniger berühmter Frauen.
Julia erklärt: „Für uns ist eine Simone eine Frau, der es an Repräsentanz mangelt, aber die wichtig für die Geschichte ist, dafür, was sie gemacht hat – und die es deshalb verdient, dargestellt zu werden.“ Darüber hinaus geht es Des Simones auch um Kritik an der Textilindustrie, die meistens in Südostasien angesiedelt ist: 80 Prozent der Arbeiter dort sind laut Julia Frauen, die unter schlechten Bedingungen schuften. Weil sie diese Arbeitsbedingungen nicht unterstützen und außerdem nicht zur Textil-Überproduktion beitragen wollen, benutzen Des Simones nur Secondhand-Shirts. „Das ist der industrielle Aspekt“, sagt Julia. „Hinzu kommt, dass die Modeindustrie nur die Frauen hervorhebt, die als schön gelten. Es gibt dieses einheitliche Frauenbild, dass alle Frauen dünn, feminin, weiß und heterosexuell sein müssen.“
Die erste Kollektion zierten die Gesichter von Simone de Beauvoir und der französischen Politikerin Simone Veil – daher der Name Des Simones. Julia hebt ihren Pulli hoch, um mir zu zeigen, was sie darunter trägt: Simone de Beauvoir blickt mich an. Julia dreht sich um und von der Rückseite lächelt Simone Veil. Zu Simone und Simone kamen später die Künstlerin Louise Bourgeois, die Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai und die Sängerin Nina Simone hinzu.
Momentan suchen Julia und ihr kleines Team nach neuen Gesichtern für die nächste Kollektion. „Es gibt immer ein Problem mit Personen, die man als Idol betrachtet. Simone Veil zum Beispiel hat sich gegen die mariage pour tous, also gegen die gleichgeschlechtliche Ehe in Frankreich ausgesprochen. Es ist kompliziert, perfekte Helden zu haben – c’est la vie. Im Gegensatz zu Simone Veil kann man Simone de Beauvoir aber idealisieren, weil sie nicht mehr lebt.“ Ich nicke und denke nach. Julia ist lesbisch, sie hat sich zunächst gegen Homophobie und die Diskriminierung von Lesben engagiert, bevor sie darüber zum Feminismus gefunden hat. Von Simone de Beauvoir las sie als erstes Memoiren einer Tochter aus gutem Haus. Beauvoir hatte ebenfalls Liebesbeziehungen mit Frauen, behauptete aber bis zu ihrem Tod, es sei nicht so. Erst die von ihrer Adoptivtochter posthum veröffentlichten Briefe an Sartre zeigten, dass Beauvoir sehr wohl sexuelle Beziehungen mit verschiedenen Frauen führte.
Die Briefe von Beauvoir an Sartre zeichnen darüber hinaus ein oft sehr unschönes Bild der Französin. Sie zeigen, wie berechnend und willkürlich Beauvoir und Sartre zuweilen mit ihrem Umfeld umgingen. Viele Mitglieder ihrer petite famille, der kleinen Familie – Liebhaber und Liebhaberinnen, Freunde und Bekannte – waren finanziell abhängig von den beiden. Beauvoir und Sartre bildeten das intellektuelle und gesellschaftliche Zentrum der Gruppe, sie hatten alle Fäden in der Hand. Fanden sie jemanden interessant, waren sie charmant und liebenswürdig – hatten sie genug von diesem Menschen, wurde kurzer Prozess gemacht.
Olga Kosakiewicz, die in den 1930ern eine Dreiecksbeziehung mit Beauvoir und Sartre führte, sagte über ihre Beziehung zu dem schillernden Paar: „Wir waren alle wie Schlangen, hypnotisiert. […] Wir taten, was sie wollten, denn was auch immer, wir waren so begeistert von ihrer Aufmerksamkeit, so privilegiert, sie zu haben.“ Beauvoirs ehemalige Kollegin Colette Audry, mit der sie in Rouen zusammen unterrichtete, erinnerte sich: „Ich kann nicht beschreiben, was es für ein Gefühl war, diese beiden zusammen zu erlebe. Es war so intensiv, dass man manchmal ganz traurig wurde, nicht auch so etwas zu haben.“
Simone de Beauvoir ist ein perfektes Beispiel für das, was Julia gesagt hat: Es ist kompliziert, perfekte Helden zu haben. Besonders im feministischen Kontext. Das Internet macht es heute sehr einfach, Menschen zu googeln, zurückzuverfolgen, was sie vor Jahren gemacht haben, wozu sie sich wie geäußert haben. Das Internet vergisst nichts. Ein als beleidigend, unsensibel oder uninformiert empfundene Äußerung kann auch Jahre später noch einen Shitstorm heraufbeschwören. Wäre Beauvoir zu der geworden, die sie ist, wenn ihr Briefverkehr mit Sartre in Kommentarspalten bei Facebook stattgefunden hätte?
Schon oft habe ich erlebt, wie verschiedene Frauen hochgejubelt und für ihre feministischen Aussagen gelobt wurden – nur um nach einem unbedachten Kommentar oder einer als unfeministisch empfundenen Handlung kritisiert und fallengelassen zu werden. Aber niemand ist perfekt und das gilt für feministische Ikonen, auch für Simone de Beauvoir.
III. Simone und der Feminismus: Eine späte Liebe
In Diskussionen und Gesprächen werde ich oft gefragt, wie ich zur Feministin geworden bin. Es ist ganz einfach: Ich bin in dem Moment zur Feministin geworden, als ich Simone de Beauvoir las. Diese Schlichtheit ist mir manchmal peinlich. Andere Feministinnen reden über Ungleichheiten, die sie wahrgenommen, Diskriminierungen, die sie erlebt haben. Ich rede über die Bücher einer toten Französin. Für mich war es so: Simone de Beauvoir, das wusste ich, war Feministin. Also wollte ich eben auch eine sein. Es gab kein Zögern, kein Hinterfragen. Ich habe diese neue Identität angenommen und sie seitdem nie wieder abgelegt. Heute kommt mir das sehr naiv vor.
Denn die Simone de Beauvoir, die ich in den Mandarins von Paris fand, in den Briefen an Sartre, sogar im Anderen Geschlecht – diese Simone de Beauvoir war keine Feministin. Tatsächlich wurde Beauvoir erst sehr spät im Leben Feministin. Das ist eine Tatsache, die oft und gerne vergessen wird. Man will es nicht glauben, schließlich hat Beauvoir schon 1949 mit Das andere Geschlecht ein feministisches Hauptwerk veröffentlicht. Warum schreibt sie über die Rechte von Frauen und fordert diese ein, wenn sie nicht selbst Feministin ist?
Beauvoir war Kommunistin, bevor sie Feministin wurde. Sie glaubte, dass eine Transformation des kapitalistischen Systems – die Auflösung des Klassenwiderspruchs – automatisch die Befreiung der Frau mit sich bringen würde. Dieses Denken entsprach dem kommunistischen Mainstream der damaligen Zeit, der 1950er, 60er, 70er. Doch dann kam die 68er Studentenrevolte, aus welcher der radikal feministische und autonome Mouvement de Libération des Femmes (MLF, Bewegung der Frauenbefreiung) entstand.
Die jungen Frauen des MLF entdeckten Das andere Geschlecht neu. Dieses war zu jenem Zeitpunkt bereits 20 Jahre alt, doch Beauvoirs Analysen hatten nichts von ihrer Aktualität und Radikalität eingebüßt. Beauvoir war der Meinung, dass die Geschlechtsidentität nichts angeboren Natürliches ist, sondern anerzogen wird: Das „weibliche Geschlecht“ ist somit ein Produkt der patriarchalen Gesellschaft.
Die Historikerin Miriam Gebhardt schreibt in ihrem Buch Alice im Niemandsland. Wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor: „Beauvoirs große Leistung war es, erstmals in einem kulturgeschichtlichen Rundumschlag die kulturellen und historischen Beschränkungen des weiblichen Geschlechts beschrieben und mit den konkreten Lebensbedingungen der gegenwärtigen Frauen verknüpft zu haben. Dabei arbeitete sie akribisch heraus, wie der weibliche Körper zum Schauplatz politischer und gesellschaftlicher Interessen wurde.“
Beauvoir, so Gebhardt, handelte „die biologischen, psychologischen und ökonomischen Bedingungen des Frauseins ab und zeigte auf, dass unter keiner dieser Kategorien von einer durch die Natur gerechtfertigten Unterlegenheit gesprochen werden könne“.
Das andere Geschlecht wurde 1949 in zwei Bänden veröffentlicht. Es verkaufte sich hervorragend, vom ersten Band gingen in der ersten Woche nach Erscheinen 22.000 Exemplare über den Ladentisch. Die Reaktionen aber waren heftig. Simone de Beauvoir erinnert sich in ihrem Memoiren-Band Der Lauf der Dinge: „Ich erhielt signierte und anonyme Epigramme, Satiren, Strafpredigten, Ermahnungen, die, zum Beispiel, äußerst aktive Angehörige des ersten Geschlechts an mich richteten. Man sagte, dass ich unbefriedigt, frigid, priapisch, nymphoman, lesbisch sei und hundert Abtreibungen hinter mir habe und sogar heimlich ein Kind hätte.“

Beauvoir wurde auf offener Straße beschimpft und bedroht, man lachte über sie und zeigte mit dem Finger auf sie. Hätte es damals schon das Internet gegeben, Simone de Beauvoir hätte wohl gar keine Ruhe mehr gehabt.
Die französische Frauenbewegung damals war in viele kleinere Gruppen zersplittert; Gruppen, die verschiedene Schwerpunkte setzten und daher nicht immer die gleichen Interessen hatten. Das Thema, welches 1970 letztendlich all diese Gruppen zusammenbrachte, war das Abtreibungsverbot. Der MLF startete eine groß angelegte Kampagne, um den entsprechenden Paragraphen abzuschaffen. Viele der jüngeren Feministinnen fanden, prominente Unterstützung könnte dabei nicht schaden – und beschlossen, Simone de Beauvoir um Hilfe zu bitten. Die hatte im Anderen Geschlecht ausführlich erläutert, warum es das Recht auf Abtreibung geben muss.
Auch die deutsche Autorin und Herausgeberin Alice Schwarzer gehörte zur Gruppe der MLF-Frauen, die Kontakt zu Simone de Beauvoir suchten. Schwarzer, damals Ende 20, besuchte Kurse an der Universität Paris-Vincennes, einem wichtigen Treffpunkt der Frauenbewegung. In ihren Memoiren erinnert sie sich:
„Gleich im Herbst 1970 gehen einige aus meiner Gruppe in die Rue Schoelcher 12 bis und klingeln bei Simone de Beauvoir. Es ist die Zeit, als Sartre als Compagnon de route, als Weggefährte der Maoisten, von sich reden macht. Und wir finden: Simone de Beauvoir, deren Jahrhundert-Essay Das andere Geschlecht uns allen die Augen geöffnet hat und ohne deren Schlüsselwerk der Neue Feminismus nicht mit solchen Siebenmeilenstiefeln hätte voranschreiten können, sie gehört an unsere Seite! Sie sieht das genauso. Wir jungen Feministinnen rennen offene Türen bei ihr ein. Sehr bald schon werden die Treffen und Essen mit der damals 61-Jährigen für uns selbstverständlich. Wir sind in der Mehrheit zwischen 30 und 40.“
Schwarzer schreibt auch: „Denn wir ‚revolutionären Feministinnen‘ sind ganz wie Beauvoir deklarierte Antibiologistinnen, Universalistinnen. Wir stehen also direkt in der Denktradition von Beauvoir.“
Was ist das für eine Denktradition? Beauvoir glaubte, wie gesagt, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau kulturell bzw. gesellschaftlich konstruiert sind. Damit steht sie in der Tradition des Gleichheits- oder Egalitätsfeminismus. Dieser geht davon aus, dass Männern und Frauen aufgrund vermeintlicher „männlicher“ und „weiblicher“ Eigenschaften Rollen zugeschrieben werden, die die Machtverhältnisse zugunsten der Männer bestimmen. Was Simone de Beauvoir schon 1949 aufschrieb, ist also ein sehr moderner Gedanke, der später durch die Gender Studies bekannt wird: das Geschlecht als soziale Konstruktion. Geschlechterrollen werden durch die Gesellschaft geprägt, sie sind nicht angeboren, sondern anerzogen. Als Gegenentwurf zum Gleichheitsfeminismus gilt der Differenzfeminismus, welcher auf der Wesensverschiedenheit von Mann und Frau sowie unterschiedlichen Geschlechterrollen besteht, aber trotzdem für Frauen eine gesellschaftliche Rolle einfordert.
Beauvoirs Feminismus ist stark existentialistisch eingefärbt. Existentialismus, das war der Name, den man u.a. den von Sartre entwickelten Theorien gab. Der Mensch, davon ging Sartre aus, ist frei und muss sich seinen Lebenssinn selbst erschaffen. Die Existenz des Menschen erhält nicht von vornherein eine Bedeutung, es ist der Mensch, der durch sein Handeln diese Bedeutung schafft – dabei darf er sich nicht hinter Traditionen oder Ideologien verstecken.
Der Existentialismus ist eine fordernde Philosophie, die dem Menschen viel abverlangt. Und so fordert auch Simone de Beauvoir in Das andere Geschlecht viel von den Frauen: Sie ruft sie dazu auf, Eigenverantwortung zu übernehmen und sich selbst aus ihrer Unterdrückung zu befreien. Dabei geht sie sehr schonungslos mit den Frauen um. Beauvoir hält viele Frauen für passiv und schwach – ihr Frauenbild ist nicht besonders positiv. Beauvoir erwartete von anderen Frauen zu sehr, mehr wie sie zu sein.
Existentialismus bedeutet also Handeln und Simone de Beauvoir beschloss, dass nun auch für sie die Zeit gekommen war, aktiv zu werden: Sie beteiligte sich am Manifest der 343, welches am 5. April 1971 im Nouvel Observateur erschien. Darin bekannten 343 Frauen, abgetrieben zu haben – u.a. die Schauspielerin Jeanne Moreau und die Schriftstellerin Marguerite Duras. Beauvoir selbst hatte, wie viele andere Unterzeichnerinnen, nie abgetrieben. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich endgültig von dem Gedanken verabschiedet, dass durch die sozialistische Revolution die Frauenfrage automatisch gelöst würde. Sie war zur Feministin geworden.
Am 6. April 1975 saß sie in der französischen TV-Sendung Questionnaires (Titel: Pourquoi je suis féministe, d.h. Warum ich Feministin bin), mit hellblauem Kopftuch, die Hände verschränkt, immer in Bewegung, offenbar nervös. Dem Moderator Jean-Louis Servan-Schreiber erklärte sie: „Die Geschichte des Kommunismus und der Frauen ist eine komplizierte Geschichte, weil der Kommunismus die Probleme der Frauen, den Geschlechterkonflikt, als zweitrangig betrachtet, im Vergleich zum Klassenkonflikt, der erstrangig ist.“
Aber das Schicksal von Frauen sei eben nicht dasselbe wie das der Männer, auch nicht in kommunistischen Ländern wie der Tschechoslowakei – und deshalb würde sie sich nun als Feministin bezeichnen. Auch das macht Simone de Beauvoir zu einem unperfekten feministischen Vorbild: Sie begann erst mit Ende 60, sich selbst als Feministin zu bezeichnen und in der Frauenbewegung aktiv zu werden. Da hatte sie gerade noch zehn Jahre zu leben.
IV. Simone als Frau: Vom Vater als Sohn behandelt
Der Rückblick in die 1970er Jahre teigt: Trotz des Altersunterschieds hatte Beauvoir eineunglaubliche Wirkung auf junge Feministinnen – so wie Jahrzehnte später auf mich. Eine der jungen Frauen von damals ist Claudine Monteil. Die Historikerin, Schriftstellerin und ehemalige Diplomatin ist Ende 60 und hat mehrere Bücher über Simone de Beauvoir geschrieben. Ihre Wohnung liegt im Pariser Montparnasse-Viertel und als ich an einem erstaunlich warmen Januarmorgen aus der Métro trete, habe ich das Gefühl, jede Ecke atmet Simone de Beauvoir.
Da ist der Friedhof Montparnasse, wo Beauvoir und Sartre ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Um die Ecke befindet sich jene Rue Schoelcher, in der Beauvoir ihre erste eigene Wohnung bezog, als sie vom Hotelleben genug hatte – und wo die Gruppe junger MLF-Feministinnen in den 1970ern begann, sich mit Beauvoir zu treffen. Auch der Boulevard Saint-Germain ist nicht weit, mit seinen berühmten Cafés und Bistros, die Beauvoir regelmäßig frequentierte.
Monteil öffnet mir die Tür – eine kleine, zierliche Frau mit auffälliger Brille und pinkfarbenem Lippenstift, das kurze Haar elegant in Form gebracht. Beim Betreten ihres Wohnzimmers fällt mein Blick sofort auf ein farbenfrohes Gemälde über der Sofaecke: Simone de Beauvoir, lächelnd, in einer gelben Bluse. Das Gemälde stammt von der Künstlerin Hélène de Beauvoir, Simone de Beauvoirs jüngerer Schwester. Claudine Monteil war eng mit Hélène befreundet – diverse Zeichnungen und Gemälde der jüngeren Beauvoir schmücken den schmalen Flur und das Schlafzimmer. Auch der Stuhl, auf dem ich mich niederlasse, stammt aus dem Nachlass Hélène de Beauvoirs.
Ich frage Monteil, wann sie das erste Mal mit Simone de Beauvoir in Kontakt gekommen ist. „Dafür muss ich ein bisschen ausholen“, sagt Monteil und lacht. Sie ist eine unterhaltsame Erzählerin, die in druckreifen Sätzen spricht und kunstvolle Pausen macht. 1949 heirateten Monteils Eltern, beide junge Wissenschaftler. Der Vater, Jean-Pierre Serre, war Mathematiker, die Mutter, Josiane Heulot-Serre, angehende Chemikerin. Als „Hochzeitsgeschenk“, wie Monteil es nennt, lud ein bekannter Mathematiker ihre Mutter zum Kaffee ein. Er sagte ihr, sie solle ihre wissenschaftlichen Ambitionen aufgeben und sich ihrem Ehemann widmen, aus dem mal ein großer Mathematiker werden würde.
Monteils Mutter trank ihren Kaffee aus und bedankte sich „für diesen Rat, den ich nicht befolgen werde.“ Sie war bereits schwanger mit Claudine und auf dem Weg nach Hause kam sie an einem Buchladen vorbei. Im Schaufenster: der soeben erschienene erste Band von Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht. Claudine Josiane Heulot-Serre kaufte das Buch, las es und beschloss, zu kämpfen. Tatsächlich wurde sie nicht nur Chemikerin, sondern später auch Leiterin der prestigeträchtigen Schule École Normale Supérieure de jeunes filles in Sèvres (ENSFJ, nicht zu verwechseln mit der École Normale Supérieure, die u.a. Jean-Paul Sartre besuchte). „Ich bin also in dem Moment geboren, als der zweite Band von Das andere Geschlecht erschien“, berichtet Monteil. „Später, als ich Simone de Beauvoir persönlich kennenlernte, sagte ich zu ihr: Nun, ich bin ein wenig das Kind des Anderen Geschlechts. Und Simone antwortete mir: Claudine, Sie sind das enfant terrible des Anderen Geschlechts!“.
Als Claudine Monteil das erste Mal an Simone de Beauvoirs Haustür klingelte, war sie 20 Jahre alt und in der 68er Studentenbewegung aktiv – eine Bewegung, die laut Monteil „sehr frauenfeindlich und macho“ war. Viele Frauen verließen die Bewegung, einige von ihnen gründeten den MLF. Die Studentin Claudine Monteil arbeitete viel mit Arbeiterinnen, leitete eine Gruppe zur Bewusstseinsbildung. Sie stand jeden Morgen um sechs auf, um in den Fabriken Flugblätter zu verteilen.
Jean-Paul Sartre, der ebenfalls in der Bewegung aktiv war und Monteil kannte, erzählte Beauvoir von dieser jungen, engagierten Frau – und Beauvoir lud Monteil zu einem der sonntäglichen Treffen bei ihr zu Hause ein. Zu der Gruppe gehörten neben Alice Schwarzer u.a. auch die Schauspielerin Delphine Seyrig und die Anwältin Gisèle Halimi. Claudine Monteil war die Jüngste, sie und Beauvoir trennten 42 Jahre. Das erste Zusammentreffen lief nicht besonders gut:„Man hatte mir gesagt, ich solle auf jeden Fall pünktlich sein, denn Simone de Beauvoir hasste Unpünktlichkeit. Um fünf vor fünf stand ich vor ihrer Haustür, wartete und drückte Punkt fünf auf die Klingel. Simone de Beauvoir öffnete die Tür und das erste, was sie sagte, war: Sie sind zu spät!“
Monteil beugt sich vor. „Nun ja, ich habe auf meine Uhr geschaut und gesagt: Entschuldigen Sie, Madame, ich bin pünktlich. Daraufhin zeigte Simone de Beauvoir auf ihre Uhr: Sehen Sie, es ist sieben Minuten nach fünf!“ Später erklärten ihr die anderen Frauen in der Gruppe, dass Beauvoirs Uhr sieben Minuten vorgehe. „Zu diesem Zeitpunkt“, sagt Monteil und streichelt ihre Katze, „war das Ganze bereits ein riesiges Desaster für mich.“ Das Idol ihrer Mutter, ihr Idol, musste sie für eine Idiotin halten. Zeit zum Verschnaufen blieb nicht, denn schon wollte Beauvoir von Monteil wissen, welche Ideen sie für die Abtreibungskampagne hätte.
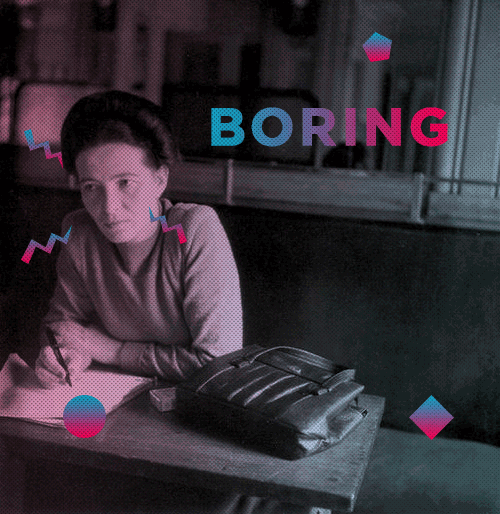 Auch Jahrzehnte nach diesem ersten Treffen funkeln Monteils Augen, wenn sie davon spricht: „Simone de Beauvoir hatte eine außergewöhnliche Stärke, nämlich, dass sie mit allen von gleich zu gleich sprach. Sie liebte es, zu diskutieren und anderen zuzuhören. Aber da sie selbst einen sehr schnellen Geist hatte und auch sehr schnell sprach, musste man genauso schnell denken und sprechen wie sie. Wenn man ihr nicht schnell genug antwortete, war’s vorbei. Man interessierte sie nicht mehr. Eine richtige Herausforderung!“.
Auch Jahrzehnte nach diesem ersten Treffen funkeln Monteils Augen, wenn sie davon spricht: „Simone de Beauvoir hatte eine außergewöhnliche Stärke, nämlich, dass sie mit allen von gleich zu gleich sprach. Sie liebte es, zu diskutieren und anderen zuzuhören. Aber da sie selbst einen sehr schnellen Geist hatte und auch sehr schnell sprach, musste man genauso schnell denken und sprechen wie sie. Wenn man ihr nicht schnell genug antwortete, war’s vorbei. Man interessierte sie nicht mehr. Eine richtige Herausforderung!“.
Dieses schnelle Denken und die Ungeduld mit anderen gehen auf Simone de Beauvoirs Vater zurück, sagt Monteil. Georges de Beauvoir hätte gerne einen Sohn gehabt – stattdessen gebar seine Frau Françoise ihm zwei Töchter. Simone wurde für ihn zum Ersatzsohn: Er sprach mit ihr, wie er mit einem Sohn gesprochen hätte, von Mann zu Mann, von gleich zu gleich. Eine Tradition, die seine Tochter weiterführte. Die junge Studentin Claudine nahm sie genauso ernst wie alle anderen.
Vermutlich war die bevorzugte Behandlung durch den Vater auch einer der Gründe, warum Beauvoir lange Zeit nicht das Gefühl hatte, als Frau benachteiligt zu werden. Sie war es gewohnt, dass man ihr zuhörte und sie ernst nahm – so machte es ihr Vater, später dann Jean-Paul Sartre. Beauvoir lernte, dass sie Männern gleichwertig war und sie ihre Meinung ohne Hemmungen äußern konnte. Was sie wiederum selbstbewusst genug machte, um ihre Ziele zu verfolgen und so zum Vorbild für andere Frauen zu werden.
Claudine Monteil beugt sich wieder vor: „Simone de Beauvoir war toll für meine Mutter, aber sie war auch toll für mich. Ich war ein Teenager, als ich ihre Memoiren las und ich sagte mir: Ich möchte ein leidenschaftliches Leben haben, wie Simone de Beauvoir.“
Für junge Frauen, so Monteil, sei Beauvoir heute eher eine „mythische Gestalt“. In der Schule würden manchmal die Memoiren einer Tochter aus gutem Haus gelesen, nur selten eine Passage aus Das andere Geschlecht: „Die jungen Leute kennen also den Namen Simone de Beauvoir, aber nicht mehr.“ Monteil hofft, dass sich das bald ändern wird. Momentan denken die Herausgeber der angesehenen Bibliothèque de la Pleïade – in der vor allem französische Klassiker der Weltliteratur erscheinen – darüber nach, die autobiografischen Schriften Beauvoirs zu veröffentlichen. Monteil glaubt, dass Beauvoir dadurch bei Lehrern und Professoren an Ansehen gewinnen wird. Ich frage mich, warum man nur die Memoiren Beauvoirs veröffentlichen will. Ist der Rest ihres Werks keine Weltliteratur? Es kommt mir so vor, als zählten Geschichten von Frauen nur, wenn sie in Form von Autobiografien vermeintlich intime Einblicke in ihr Leben geben. Daran hat sich auch heute nichts geändert.
Was mir auffällt, während ich Claudine Monteil zuhöre, ist nicht nur die Begeisterung, mit der sie von Simone de Beauvoir spricht. Es ist auch ihr Wille, den Ruf ihres Vorbildes zu bewahren. Eine Art Beschützerinstinkt. Als ich Hazel Rowleys Buch Tête-à-tête: Leben und Lieben von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre anspreche, reagiert Monteil etwas verschnupft. „Da geht es ja nur um Sex!“ Tatsächlich hat Rowley akribisch sämtliche Beziehungen und Affären Beauvoirs und Sartres recherchiert – das Ganze liest sich sehr unterhaltsam, ohne voyeuristisch zu sein. Monteil sieht das offenbar anders.
Im Gespräch mit älteren Feministinnen erlebe ich diese Abwehrhaltung oft: Sie haben das Gefühl, dass Simone de Beauvoir immer noch zu sehr auf ihre Beziehung mit Sartre reduziert wird, dass dieser Beziehung zu viel Platz eingeräumt wird. Und doch ist es diese Beziehung, die heute noch viele junge Frauen – Feministinnen oder nicht – fasziniert.
V. Simone und Sartre: Offene Beziehung und gewollte Kinderlosigkeit
Zwei Monate später treffe ich in Berlin Manon, eine Bekannte hat den Kontakt hergestellt. „Manon hat sich gerade erst wieder durch die Bücher von Beauvoir gelesen“, schreibt sie. Manon ist 22 und studiert an der Pariser Elite-Uni Sciences Po Politikwissenschaften, hat ein Jahr als Erasmus-Studentin in Berlin verbracht und ist gerne bereit, sich bei einem ihrer Besuche in der Stadt mit mir zu treffen. „Ich bin aber keine Beauvoir-Expertin“, schreibt sie mir in einer Mail. In einem gemütlichen Café in Schöneberg entdecken wir viele Gemeinsamkeiten.
„Ja, ich bezeichne mich selbst als Feministin“, sagt Manon und dass sie den Feminismus durch Simone de Beauvoir entdeckt habe. „Mit 15 habe ich die Memoiren einer Tochter aus gutem Hause gelesen. Ich habe dieses Buch geliebt, weil ich mich darin total wiedergefunden habe. Beauvoir sprach in diesem und anderen Büchern nicht direkt vom Feminismus, aber ich habe angefangen, im Internet ein bisschen über sie zu recherchieren – und dabei das Thema Feminismus entdeckt.“
Auch in anderer Hinsicht hat Beauvoir Manon beeinflusst: „Ich mochte immer sehr diese Idee der freien Liebe, wie Beauvoir und Sartre sie lebten. Natürlich gab es da auch Probleme, trotzdem fand ich diese Beziehung sehr interessant. Ich selbst bin quasi in eine offene Beziehung gestolpert. Es war einfach selbstverständlich. Ich könnte mir nicht vorstellen, nicht in einer offenen Beziehung zu leben.“ Umso enttäuschter war Manon, als sie Sie kam und blieb las – Beauvoirs Debutroman von 1943, in dem sie die Dreiecksgeschichte zwischen ihr, Sartre und Olga Kosakiewicz literarisch verarbeitet: „Beauvoir hätte mit diesem Buch zeigen können, wie das funktioniert, so eine offene Beziehung. Stattdessen ging es nur um Eifersucht. Das fand ich schade, weil es eine verpasste Gelegenheit war.“
 Viel ist darüber geschrieben und gelästert worden, dass die angeblich so gleichberechtigte Beziehung zwischen Beauvoir und Sartre alles andere war als das. 1929 hatten die beiden einen Pakt geschlossen, der ihre Beziehung als „notwendige Liebe“, als amour nécessaire, definierte, welche aber auf „Zufallslieben“, amours contingents, nicht verzichten sollte. Außerdem würden sie immer aufrichtig zueinander sein – absolute Ehrlichkeit. Der Autor Walter van Rossum schreibt in seinem Buch Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre: „Hier geht es um die Geschichte zweier Menschen, die versucht haben, auf dem Schotter der Ungewissheit ein Reich der Verbindlichkeiten zu errichten. Es war nicht immer leicht und es ist nicht immer gelungen. So ist das in Zeiten, wo jedes Leben zum Selbstversuch wird.“
Viel ist darüber geschrieben und gelästert worden, dass die angeblich so gleichberechtigte Beziehung zwischen Beauvoir und Sartre alles andere war als das. 1929 hatten die beiden einen Pakt geschlossen, der ihre Beziehung als „notwendige Liebe“, als amour nécessaire, definierte, welche aber auf „Zufallslieben“, amours contingents, nicht verzichten sollte. Außerdem würden sie immer aufrichtig zueinander sein – absolute Ehrlichkeit. Der Autor Walter van Rossum schreibt in seinem Buch Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre: „Hier geht es um die Geschichte zweier Menschen, die versucht haben, auf dem Schotter der Ungewissheit ein Reich der Verbindlichkeiten zu errichten. Es war nicht immer leicht und es ist nicht immer gelungen. So ist das in Zeiten, wo jedes Leben zum Selbstversuch wird.“
Heute, nach Veröffentlichung der Briefe Beauvoirs an Sartre, wissen wir: Es war tatsächlich ein Selbstversuch, der nicht ohne Eifersucht und Machtkämpfe auskam. Das bekannteste Intellektuellen-Paar des 20. Jahrhunderts, es bestand eben auch nur aus Menschen. Doch trotz des ganzen Liebeswirrwarrs, trotz vieler kleiner und großer Eifersüchteleien: Der Pakt bot Beauvoir unbestreitbare Vorteile. Als Partnerin Sartres hatte sie viel mehr Freiheiten als andere Frauen der damaligen Zeit. Freiheit passiert nicht einfach, sie muss erkämpft werden – auch und besonders in einer Beziehung, das wusste Simone de Beauvoir.
Natürlich, sagt Manon und rührt in ihrem Kaffee, war die Beziehung zwischen Beauvoir und Sartre auch deshalb möglich, weil die beiden keine Kinder hatten: „Das war eine bewusste Entscheidung von Simone de Beauvoir. Sie hat sie gerechtfertigt, indem sie sagte: Ich kann nicht gleichzeitig an meinem Werk arbeiten und ein Kind lieben. Und das ist etwas, was ich mir für mich auch vorstellen könnte – eigentlich möchte ich keine Kinder haben.
Diese Überlegung hat tatsächlich mit Simone de Beauvoir angefangen. Als ich ihre Bücher las, und sie darüber schrieb, dass sie sich bewusst gegen Kinder entschieden hätte, da merkte ich, dass das etwas ist, was ich schon immer gedacht habe.“ Sie fährt sich durch ihre kurzgeschnittenen braunen Haare.
Genau diese Ablehnung von Mutterschaft, die Simone de Beauvoir in Das andere Geschlecht ausführlich darlegte, macht es heute aber vielen jungen Feministinnen schwer, sich mit der Französin zu identifizieren. Beauvoir beschrieb das Kinderkriegen als Bürde, Mutterschaft und Hausarbeit waren in ihren Augen eine „Falle“. In Das andere Geschlecht schreibt sie: „Die große Gefahr, der unsere Sitten das Kind aussetzen, besteht darin, dass die Mutter, der man es hilf- und wehrlos anvertraut, als Frau fast immer unbefriedigt ist. Sexuell ist sie frigide oder unerfüllt, sozial fühlt sie sich dem Mann unterlegen. Sie hat weder Einfluss auf die Welt, noch auf die Zukunft. Und nun sucht sie über das Kind, all diese Frustrationen zu kompensieren.“ Eine damals wie heute radikale Position.
Ich habe den Eindruck, dass es auch heute noch schwierig ist, über gewollte Kinderlosigkeit zu sprechen. Kinder zu bekommen gilt als „natürlichste Sache der Welt“, in Frankreich noch mehr als in Deutschland. Sich öffentlich negativ über Mutterschaft zu äußern, bleibt ungewöhnlich – in Frankreich tut dies vor allem Élisabeth Badinter, in Deutschland vor allem Alice Schwarzer. Es ist kein Zufall, dass beide zu jener Generation Feministinnen gehören, die in den 1970ern Simone de Beauvoir neu entdeckten. Dass eine junge Frau wie Manon sich gegen Kinder entscheidet und sich dabei auf Simone de Beauvoir beruft, ist die Ausnahme.
Manon und ich sind beide Jahrzehnte nach Erscheinen des Anderen Geschlechts geboren, Beauvoir starb knapp zwei Jahre vor meiner Geburt. Simone de Beauvoir ist für uns eine Person, mit der wir uns intensiv beschäftigt haben, die ein Vorbild für uns ist. Wir bedauern, sie nicht persönlich gekannt zu haben, würden ihr gerne so viele Fragen stellen. Aber vielleicht ist unsere späte Geburt im Umgang mit Simone de Beauvoir nicht nur ein Nachteil. Wenn ich Frauen wie Alice Schwarzer oder Claudine Monteil, die beide Beauvoir als junge Frauen kennenlernten, über Beauvoir reden höre, dann höre ich große Begeisterung, Bewunderung, Wärme. Aber diese Nähe verhindert vermutlich auch einen kritischen Abstand zu Simone de Beauvoir.
Denn obwohl Manon Simone de Beauvoir als Idol betrachtet und viele ihrer heutigen Positionen auf sie zurückführt – unkritisch ist sie deshalb nicht. Gerade, wenn es um Beauvoirs Feminismus geht. „Sie war nicht unbedingt eine einfache Figur“, sagt Manon. „Sie war sehr bourgeois, hat viele Sachen geschrieben, die sehr exklusiv sind. Und im Anderen Geschlecht gibt es viele Passagen, die ein bisschen altmodisch sind. Ich glaube, das Buch war für die damalige Zeit sehr wichtig, aber heute kann ich daraus nichts Neues mehr lernen. Das andere Geschlecht ist eher ein historisches Zeugnis des Feminismus.“ Für Manon ist es schwierig, eine Verbindung zu Simone de Beauvoir zu haben: „Sie ist schon so lange tot.“
Epilog
Seit einem Jahrzehnt begleitet Simone de Beauvoir mich nun schon. Ihre Bücher und Schriften haben mir Orientierung gegeben und tun es immer noch. In manchen Jahren las ich Beauvoir systematisch, arbeitete mich durch ihre Memoiren und Briefe und wendete mich dann ihren Romanen zu. In anderen Jahren las ich kaum etwas von Beauvoir – fühlte mich aber beruhigt durch den Anblick der Bücher in meinem Regal: Wenn ich Simone de Beauvoir bräuchte, sie wäre da.
Wenn ich meine alten Tagebücher durchblättere und die enthusiastischen Einträge über Simone de Beauvoir sehe, wünsche ich mir diese Unbeschwertheit manchmal zurück. Die Zeit, wenn man etwas oder jemanden ganz neu entdeckt, sich mit unvoreingenommener Begeisterung darauf stürzt und es noch so viel zu entdecken, zu lernen gibt. Denn mit der Zeit kommt Wissen, Wissen über das Objekt der Begeisterung – und nicht immer gefällt einem, was man da lernt.
Ja, manchmal wünschte ich, ich könnte die Bücher von Simone de Beauvoir nochmal lesen, ohne zu wissen, dass ihr Frauenbild problematisch war, wie schnell sie das Interesse an Menschen verlor, die mit ihrem intellektuellen Tempo nicht mithalten konnten, wie fordernd und streng sie sein konnte. Und doch ist es all das, was Simone de Beauvoir ausmacht. Die Widersprüche, die menschlichen Makel. Ich bin überzeugt, dass man aus diesen genauso viel lernen kann wie aus den Vorteilen und positiven Seiten eines Menschen. Beauvoir mag in vielerlei Hinsicht kein perfektes – feministisches – Vorbild gewesen sein, aber sie war doch ein Vorbild. Ich sehe es an mir selbst, an jungen Frauen wie Manon und Julia, und an älteren Frauen wie Claudine Monteil.
Uns jungen Frauen mag es schwer fallen, den revolutionären Charakter zu begreifen, den Simone de Beauvoir Zeit ihres Lebens verkörperte – wir können ihn uns nur vorstellen. Wir leben heute Freiheiten, die wir auch dank Beauvoir haben. Aber das vergessen wir oft. Wir können auch deshalb so kritisch gegenüber Beauvoir sein, weil wir nicht erlebt haben, was es bedeutet, eine junge Frau in den 1920er, 30er, 30er Jahren zu sein.
Es wundert mich deshalb nicht, dass junge Feministinnen wie Julia, Manon und ich alle erst die Memoiren einer Tochter aus gutem Haus gelesen haben, bevor wir uns an andere Bücher Beauvoir, gar an Das andere Geschlecht, wagten. Die Memoiren mögen kein dezidiert feministisches Buch sein, aber in ihnen fand sich alles, was Beauvoir für uns so faszinierend machte: Der Wunsch, etwas aus sich zu machen, der Drang nach Freiheit – die Geschichte einer Emanzipation. Die Konsequenz, mit der Simone de Beauvoir aus ihrem Leben ihr Werk machte, hört nie auf, mich zu faszinieren.
Wenn ich heute Das andere Geschlecht lese oder auch die Memoiren einer Tochter aus gutem Haus, dann kommt mir vieles davon sehr altmodisch und überkommen vor. Und dann finden sich Passagen, ganze Seiten, die könnten heute geschrieben worden sein. Ich glaube, dass Simone de Beauvoir immer noch Relevanz hat und dass sie eine neue Generation junger Frauen interessieren und inspirieren könnte. Dafür müsste es aber erst einmal die Möglichkeit geben, diese außergewöhnliche Schriftstellerin, Philosophin und Feministin zu entdecken. Und das ist nicht so einfach. Denn die überlebensgroße Figur, der Mythos, zu dem Beauvoir geworden ist, schüchtert ein.
Man traut sich nicht richtig an Beauvoir heran – selbst viele Feministinnen haben Das andere Geschlecht nicht gelesen, weil das Buch ihnen so dick und kompliziert vorkommt. Und auch, weil sie sich von dem Buch keine revolutionären Einsichten erhoffen.
In einem meiner alten, schwarzen Moleskine-Tagebücher habe ich folgenden Satz von Simone de Beauvoir notiert: „Andererseits dachte ich an mich selbst wie an jemanden, aus dem erst noch etwas werden sollte, und hatte dabei den Ehrgeiz, unendlich weit vorzudringen.“
Es ist das, was Simone de Beauvoir heute noch zu einer solchen Ausnahmegestalt macht: Der Wille, immer weiter zu gehen, sich selbst nie genug zu sein.

